Gaston
Gaston
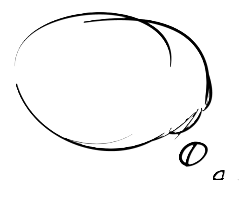
Gaston
DER DOPPELTE GASTON
Von Andreas C. Knigge
Aus nur zwei Gründen werden künftige Historiker das sonst eher triste 1957 wohl nicht gänzlich unter den Tisch fallen lassen. Der eine ist das monotone Piepen, das aus einer sitzballgroßen Aluminiumkugel namens »Sputnik« drang, der andere der Auftritt von Gaston Lagaffe, dem ein Name zunächst noch fehlte. Franquins Schöpfung zählt, wie Chaplin oder jede Zeile Flann O’Briens, zu den Geniestreichen der absurden Komik, geboren, aus einer Laune heraus, im Königreich Belgien, dessen Comic-Kultur soeben ihre Blütezeit erlebt. Gaston kam kurz vor mir zur Welt und auch bereits ein Stück größer, als ich es fünf Wochen später war. Der Blick allerdings, mit dem er zu Beginn jenes Jahres unversehens in der Redaktion der belgischen Jugendzeitschrift »Spirou« stand, dürfte dem recht ähnlich sein, mit dem auch ich 1957 rätselte, was ich hier denn wohl verloren hatte. Schon bald sollten sich unsere Wege ständig kreuzen.
Bereits bei der ersten fundamentalen Lebensentscheidung eines jeden Teenagers in den Sechzigern – noch bevor man sich einschwor auf die Beatles oder auf die Stones – redete Gaston in meinem Fall gehörig mit, bei der Frage nämlich, ob nun die »Micky Maus« cooler war oder »Fix & Foxi«. Die Geschichten von Carl Barks und Paul Murry (deren Namen noch gar keiner kannte) wogen schwer. Auf der anderen Seite aber pokerte Rolf Kauka mit den Helden aus »Spirou«, von Schnieff und Schnuff über Prinz Edelhart und die Minis bis hin zu Kokomiko (der später zum Marsupilami wurde, aber das ist, wie Kipling sagen würde, eine andere Geschichte). Gaston war das Zünglein an der Waage – obwohl man ihn »Jo-Jo« nannte und es auch noch lustig fand, ihn in der Kauka-Übertragung sto-stottern zu lassen. Gaston war es auch, der mich, als mich die Pubertät befiel, davor bewahrte, statt Comics nun die »Bravo« zu lesen, wie es meine Mitschüler einer nach dem anderen taten.
Wir waren elf, als wir uns kennenlernten. »Jo-Jo« hatte seinen ersten »FF«-Auftritt im Sommer 1968, und dass von da an alles verrückter lief, zeigte sich überall, wohin man auch sah. Eben noch hatten in Berlin und Paris die Straßen gebrannt, jetzt schneite es plötzlich, mitten im Juli. Irgendwas war ins Taumeln geraten, wankte. Gaston verkörperte das Gefühl der Veränderung in seiner Rast- und Grenzenlosigkeit und liefert mit seinem schlaksigen Äußeren den Gegenentwurf zur nervös verklemmten Generation Bruchmüller gleich mit – ein Freigeist, den keine Konventionen scheren und für den »das war schon immer so« kein Argument ist. Über den Wolken, wo er gedanklich kreist, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Gleichzeitig aber liegt Gaston mit der Welt in ähnlichem Hader wie schon Tatis Monsieur Hulot mit der Zeit der neuen Apparate. Alles entpuppt sich am Ende als weit tückischer als gedacht, sogar Naturgesetze können sich gegen einen verschwören, moderne Technik sowieso, und was aus dem Ruder laufen kann, das läuft zwangsläufig aus dem Ruder.
Auf seiner ersten Seite in »Fix & Foxi«, einer halben, um genau zu sein (Nr. 326, hier auf Seite XX), präsentiert Gaston ein praktisch gedachtes neues Ablagesystem, nur hat er den Zug der Gummibänder nicht einkalkuliert und so endet alles im Desaster. Exakt das erlebe ich, als ich zwanzig Jahre später André Franquin in Brüssel besuche. Wir stehen in seinem Atelier, er will auf dem Zeichentisch Platz schaffen und räumt einige »Marsupilami«-Blätter zur Seite, wobei sein Finger in das Gummiband gerät, an dem der Radiergummi befestigt ist, damit er nicht ständig verschwindet. Als sich Franquin von dem Gummi befreit, schießt der Radiergummi quer durch den Raum an mir vorbei, prallt ab von der Wand und verfehlt nur um ein Haar die Scheibe in der Tür. »M‘enfin?!«, sagt Franquin, als er sieht, dass nichts passiert ist, »Was denn?!«, zuckt die Schultern und grinst.
Zurück zu dem bedripsten Blick, mit dem Gaston am 28. Februar 1957 zum ersten Mal in die Öffentlichkeit trat, ohne Namen noch und auch ohne ersichtlichen Grund für sein da sein. »Was habe ich hier verloren?«, scheint der zu sagen und wohl auch, dass es gar nicht tragisch wäre, wenn niemand ihn zur Kenntnis nähme. Kaum anders wird gut zehn Jahre zuvor Gastons geistiger Vater in der Redaktion von »Spirou« gestanden haben, um als gerade Zweiundzwanzigjähriger ohne jede Referenz von seinem großen Vorbild Joseph Gillain alias Jijé die Titelserie »Spirou und Fantasio« zu übernehmen. Damit hat er längst Furore gemacht, als er zusätzlich mit Gaston beginnt, der nach seinen ersten rätselhaften Auftritten, stets umrahmt von blauen Fußabdrücken, noch im Dezember des Jahres zum (Anti-) Helden einer halbseitigen Comic-Serie wird und fortan Katastrophen am laufenden Band produziert. »Ich habe eine ständige Angst, mich zu blamieren, etwas umzukippen etwa oder etwas zu tun, das durch meine Ungeschicklichkeit schiefgeht«, erzählt Franquin später. »In diesem Punkt bin ich das exakte Ebenbild von Gaston.«
Das soll sich keine halbe Stunde später bestätigen. »Bestimmt springt jetzt der Wagen nicht an«, witzelt Franquin noch in der Tiefgarage, als wir mittags zum Essen fahren. Anspringen tut er zwar, gibt aber bald derart kuriose Geräusche von sich, dass Franquin erst einmal die nächste Tankstelle ansteuert. Als wir dann endlich in einem exklusiven thailändischen Restaurant sitzen (einem von der Sorte, in dem jede Ungeschicklichkeit peinlich auffällt), wählt er treffsicher die kompliziertesten Gerichte aus, schiebt mir mit den Worten »musst du probieren« davon auf den Teller und ist nicht mehr allein konfrontiert damit, verdauliche Petitessen aus massiven Schalen und Krusten herauszukniffeln, deren Funktion es ist, gerade das zu vereiteln.
Charles Schulz hat einmal gesagt, das Zeichenbrett sei der einzige Ort, an dem er sich je sicher gefühlt habe. Auch Franquin fremdelt, fühlt sich überfordert oder aus der Zeit gefallen und für die Tücken des Alltags somit geradezu auserkoren. Gaston wird zu einer Art Ventil, ein Weg, mit den immer häufiger auftretenden depressiven Phasen unverfänglich zu jonglieren, zu überspielen, was sein Leben zunehmend verdüstert. 1960 erscheint ein erstes »Album«, im schmalen Querformat mit nur einem Bildstreifen pro Seite, und als das ein Remake erfährt, zeichnet Franquin für die Rückseite einen Gaston, dem von der Leiter gerade ein Farbtopf auf den Kopf gefallen ist. Bis zum Bauchnabel hinab ist er pechschwarz eingekleistert – da ist es, das erdrückende, ausweglose Dunkel, das Franquin ständig befällt, aus heiterem Himmel. Nur Gastons Augen sowie seine Hände und Füße sind auf der Zeichnung noch zu sehen, wenigstens seine Agilität hat nicht gelitten.
Bei Franquin sieht das inzwischen ganz anders aus. Ende 1961 muss er sein laufendes »Spirou und Fantasio«-Abenteuer »QRN ruft Bretzelburg« in der Mitte abbrechen und kann die Arbeit daran erst nach anderthalb Jahren wieder aufnehmen. »Ich bekam keine Hintergründe mehr hin, keine Möbel«, sagt er. »Ich sah keinen Sinn mehr im Zeichnen und habe aufgehört.« Gastons Malaisen aber setzt er fort, jede Woche, ohne Unterbrechung. Wie Schulz und Franquin ein Lebensgefühl teilten, so sind auch ihre Alter Egos Charlie Brown und Gaston Lagaffe Schicksalsgefährten. Beide kommen einfach nicht an gegen die Widernisse und Hürden des Alltags und des Lebens, wie sehr sie sich auch mühen. Und dennoch lassen sie sich nicht unterkriegen, strampeln unbeirrt weiter und bleiben trotzdem reinen Herzens.
Oft genug machen sie gute Miene zum bösen Spiel. Anfang der Siebziger beginnt Gaston in »Spirou« gelegentlich zu fehlen oder statt der 1966 eingeführten ganzen Seite erscheint nur eine halbe, wie zu Beginn. 1975 tritt Gaston sogar nur ganze zwei Mal auf und acht Jahre darauf blockiert die Depression Franquin dann vollends. Er muss das Zeichnen aufgeben und sich damit auch von dem nimmermüden Eigenbrötler trennen, über den er den lähmenden Trübsinn all die Jahre zu Gags transformiert hatte, über die sein Publikum herzhaft lacht. »Was denn?!«
Längst ist der liebenswerte Nonkonformist bei den »Spirou«-Lesern so populär, dass seine Katastrophen über Jahre sogar regelmäßig auf der Titelseite erscheinen. 1983 jedoch bringt Franquin nur einen einzigen Gag zustande (Nr. 921, Seite XX), einen nächsten dann erst wieder drei Jahre später, und während der folgenden fünf gerade zehn weitere, den letzten am 25. Juni 1991. Danach ist Schluss – bis 1996 auf einmal neue Seiten erscheinen, so viele wie das gesamte Jahrzehnt zuvor. Alles lässt auf ein Comeback hoffen, eine Überwindung der Depression vielleicht, aber dann, in den frühen Morgenstunden des 5. Januar 1997, zwei Tage nach seinem dreiundsiebzigsten Geburtstag, erliegt Gastons Schöpfer einem Herzversagen. Eine letzte Seite bleibt unvollendet, die Ambulanz, die Wachtmeister Knüsel darauf zur Hilfe kommt, kommt für Franquin zu spät.
Natürlich fällt einem die Geschichte vom traurigen Clown ein, die Anfang des 19. Jahrhunderts Joseph Grimaldi in England gerne als Zote über sich selbst zum Besten gab: Ein Mann klagt über Depressionen, worauf der Arzt ihm rät, sich von dem berühmten Grimaldi aufheitern zu lassen. »Aber der bin ich doch!«, erwidert der Mann. Franquin hat mit seinem Alter Ego Gaston Lagaffe das Kunststück vollbracht, uns von der Verlorenheit, von der er ein Vierteljahrhundert lang Woche für Woche erzählte, kein Stück spüren oder auch nur erahnen zu lassen, ganz im Gegenteil: Gaston ist eine vor Lebenslust sprühende Hommage an den unbeschwerten Geist, an eine Leichtigkeit des Seins, die Franquin selbst viele Jahre nur am Zeichenbrett erfahren konnte. Und zeitweise nicht einmal das.
Doch sein wunderbares Vermächtnis ist, dass er uns auf so charmante Weise – inszeniert mit formidablem Strich – über sein chaotisches Ebenbild ganz unbeschwert lachen lässt. Und uns ermutigt, das Gesummse und all den Irrsinn um uns herum doch ein klein wenig lässiger zu schultern als die aufgeregten Bruchmüllers und Knüsels dieser Welt. Davor verneige ich mich.
(Vorwort zu André Franquin: Gaston-Gesamtausgabe , Carlsen Verlag, Hamburg 2015)
